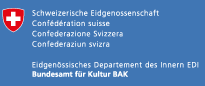Der Hahnenmoospass war in alten Zeiten ein wichtiger direkter Übergang zwischen Adelboden im Entschligetal und Lenk im Simmental. Im Jahr 1905 wurde durch Gottfried Bircher von Frutigen die erste Passherberge erbaut. Jakob Reichen-Zeller von Adelboden kaufte 1919 das Gebäude und liess es 1928 vergrössern. Neben diesem Berghaus entstand 1966 das neue Berghotel, das 1980/81 erweitert wurde.
Bereits ab 1935/36 führte im Winter ein Schlittenaufzug, der den Namen von Fridtjof Nansens norwegischem Forschungsschiff «Fram» trug, in zwei Sektionen von Geils zum Hahnenmoospass. 1954/55 wurde dieser Schlittenaufzug durch eine Zweier-Sesselbahn ersetzt.
Anstelle der Sesselbahn errichtete die Firma Habegger 1974 eine auf der Giovanola-Technik basierende Einseilumlaufbahn mit kuppelbaren Kabinen. Die eine Sektion umfassende Bahn ist mit 81 Kabinen der Oltener Firma CWA ausgestattet, bei denen erstmalig vollautomatische Türöffnungen eingesetzt wurden. Die Gehänge sowie die als Verbindung mit dem Seil verwendeten Gewichtsklemmen stammen von Giovanola Habegger. Das Förderseil wird von 13 schlanken Fachwerk-T-Stützen getragen.
Die vom Büro Künzi + Knutti, Adelboden projektierten Stationen orientieren sich formal an der lokalen Architekturtradition. Die grossvolumigen Baukörper bestehen aus einem massiven Sockel mit einem Aufbau in Stahl und Holz, der teilweise verrandet ist. Die Stationsbauten zeigen eine Aufteilung in Kundenabfertigung, Werkstattbereich und Kabinen-Garagierung. Die Südfassade der Talstation wurde 2004 geöffnet, damit ein neuer Eingang ohne Treppe entstehen konnte.
Der Antrieb ist in der Talstation, während die Förderseilabspannung sich in der Bergstation befindet. Für die Beschleunigung und Verzögerung der Fahrzeuge in den Stationen wird das neuere System mit Luftreifen eingesetzt.
Die wesentlich aus der Erstellungszeit stammende Anlage erhielt 2004 einen neuen Motor der Firma ABB und die Frey AG baute eine neue Steuerung und Fernüberwachungsanlage ein.
Die seit 1931 von Adelboden bis ins Bergläger führende Strasse wurde 1936/37 bis nach Geils verlängert. Die primär für den Busverkehr bestimmte Strasse ist vom motorisierten Individualverkehr nur kostenpflichtig befahrbar. Von der Lenker Seite her führt seit 1960 ein Skilift (2006 ersetzt) vom Bühlberg auf den Hahnenmoospass. Die Luftseilbahn Lenk-Metsch und die Skilifte Metsch wurden 1972/73 errichtet.
Bei der Geils-Hahnenmoos Bahn handelt es sich um die erste vollautomatische Gondelbahn der Schweiz. Sie wurde 1974 als Ersatz für die den gesteigerten Anforderungen nicht mehr genügende Doppelsesselbahn erstellt. Die auf der Giovanola-Technik basierende Einseilumlaufbahn mit kuppelbaren Kabinen der Firma Habegger ist mehrheitlich überliefert. Sie steht am Anfang einer Reihe von Bahnen, welche die bekannte Herstellerfirma aus Thun nach diesem Prinzip erbaute. So etwa die Bahnen Stöckalp-Melchsee Frutt (1976; 72.090) und Grindelwald Grund-Männlichen (1978; 72.093/094).
| | |
|---|
| Konzeption | | |
|---|
| Erschliessungsidee (Vision) |  | Ersatzbahn: von Ausgangspunkt Geils direkte Verbindung zum Hahnenmoospass |
| Linienführung: Planung, Umsetzung |  | direkt über Alp; relativ flache Linie |
| Seilbahntechnik | | |
|---|
| besondere oder typische tech. Konstruktion, Ausführung, Lösung, Materialien |  | konventionelle Anlage; Giovanola-Technik (Klemmapparat, Gehänge u. Stützen); erstmalig vollautomatische Öffnung der Kabinentüren; Beschleunigung u. Verzögerung in den Stationen ursprünglich mit Schwerkraft bzw. Rampe, neu mittels System Luftreifen unter Beibehaltung der Rampe; schlanke Fachwerkstützen |
| seilbahntechnische Bedeutung: Prinzip, Hersteller |  | erste vollautomatische u. mehrheitlich überlieferte, auf der Giovanola-Technik basierende Habegger-Einseilumlaufbahn mit kuppelbaren Vierer-Kabinen (vgl. 72.090 u. 72.093/094) |
| Baukunst: Streckenbauwerke, Hochbauten | | |
|---|
| Ingenieurbau | - | - |
| Architektur |  | orientiert sich formal an der lokalen Architekturtradition (zeitlose Bergarchitektur); grossvolumige, jedoch gut gegliederte Baukörper; Teil einer kompakten u. insgesamt einheitlich ausgebildeten Baugruppe auf dem Hahnenmoospass |
| besondere oder typische arch. Konstruktion, Ausführung, Lösung, Materialien |  | Mischkonstruktion: Massivbauweise (Sockel), Stahl- u. Holzkonstruktion (Einwandung mit Holz, z. Teil verrandet), Steildach; Aufteilung: Werkstattbereich, Kabinen-Garagierung, Kundenabfertigung, Antriebssektor (Talstation), Abspannung (Bergstation) |
| bautypologische Bedeutung |  | Hochbauten als wesentliche, aus der Erstellungsszeit stammende u. minimal veränderte Anlagekomponenten; Unterteilung der Baukörper nach Funktionen |
| Authentizität: materielle, ideelle Überlieferung | | |
|---|
| Umfang und Qualität der ursprünglichen Komponenten |  | in einem eindrücklichen Masse überlieferte Anlage |
| Qualität der Nachrüstungen |  | minimale, auf bestehendes System abgestimmte Nachrüstungsphase 2003: Motor, Fernüberwachung u. Steuerung |
| funktionale Unversehrtheit |  | nach wie vor als Winter- u. Sommeranlage u. Zubringer zum Hahnenmoospass in Betrieb |
| Kulturgeschichte | | |
|---|
| Personen, Firmen, Institutionen | - | - |
| Wirtschaft, Tourismus, Verkehr, Militär |  | primär touristische Nutzung, seit der Einrichtung der Kabinenbahn sowohl im Sommer als auch im Winter; zeitweilig (bis zweites Drittel 20. Jahrhundert) war die Anlage auch von militärischer Bedeutung: die Seilbahnkompanie führte übungshalber Materialtransporte über den Hahnenmoospass aus |
| Räumliche Situation | | |
|---|
| Berücksichtigung der Landschaft, der natürlichen Umgebung, des urban. Kontexts |  | zweckmässig |
| Infrastruktur | | |
|---|
| touristische/betriebliche Infrastruktur |  | Bergrestaurant, verschiedene Aufzugsanlagen, unter anderen auch solche, die die Verbindung mit dem Nachbarkurort Lenk ermöglichen |
| Verkehrsnetze |  | Strasse nach Adelboden-Geils für motorisierten Individualverkehr; ab den 1930er-Jahren etappenweise Erschliessung des Hahnenmoospasses durch Strasse (heute Zugang nur für Anstösser); ÖV eher umständlich (Zug bis Frutigen, dann per Bus) |